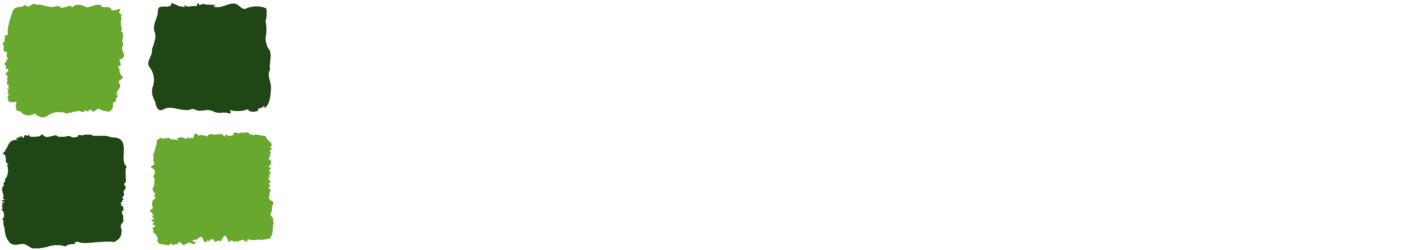Erhalt und Entwicklung einer vielfältigen, eigenartigen und schönen Landschaft gelten als wesentliche Grundlagen für die Identifikation des Menschen mit seiner Umwelt.
Die heutige Landschaft ist dabei bereits weitestgehend vom Menschen gestaltet oder überformt (kultiviert) – gleichwohl kann auch eine Kulturlandschaft vielerorts Hinweise auf die ursprüngliche Ausstattung des Raumes geben. Historisch gewachsen bringt sie die menschliche Inwertsetzung der natürlichen Standortverhältnisse zum Ausdruck.
 Quelle: pixabay.com
Quelle: pixabay.com
Zur Darstellung und Bewertung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit werden Landschaftsräume in Teilgebiete – Landschaftsbildeinheiten – abgegrenzt, welche in ihrem Erscheinungsbild mehr oder weniger homogen sind und deren Charakter im Gelände als Einheit erlebbar ist. Ihr Wirkungsgefüge kann sich durch kleinräumige Strukturwechsel auszeichnen, aber auch durch Weitläufigkeit und Monotonie.
Um das Schutzgut planerisch adäquat zu berücksichtigen, muss ein Untersuchungsgebiet die Gesamtausdehnung aller betroffenen Landschaftsbildeinheiten umfassen. Gerade bei Vorhaben mit großer Fernwirkung reicht deshalb für gewöhnlich der „Umkreis der 15-fachen Höhe“ nicht aus. Das Untersuchungsgebiet ist vielmehr den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen, um den Anforderungen an eine moderne und nachhaltige Planung gerecht zu werden.
Grundsätzlich können Angaben aus Landschaftsrahmenplänen zur Charakterisierung zweckdienlich sein. Für Landschaftsbildeinheiten, zu denen keine oder nur unzureichende bzw. veraltete Beschreibungen vorliegen, sind Eigenart, Gestalt, Nutzungsform, Ausstattung und Wirkungsgefüge zunächst durch Abgleich von Luftbildern und Biotoptypenkartierungen zu ermitteln und anschließend durch gezielte Geländekartierungen zu konkretisieren bzw. zu aktualisieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf vorhandene oder nicht mehr bestehende Vorbelastungen zu richten.
 Quelle: pixabay.com
Quelle: pixabay.com
Solche Beeinträchtigungen können sowohl statisch als auch dynamisch wirken und überdies mit unterschiedlich starker Intensität die Wertigkeit einzelner Kompartimente reduzieren. Sie werden regelmäßig hervorgerufen durch weit sichtbare Vertikalstrukturen wie Türme, Masten, Schornsteine und Freileitungen, lineare (horizontale) Strukturen wie Straßen, Trassen und Kanäle sowie durch anthropogene Nutzung.
Das Planverfahren sollte indessen frühzeitig und eindeutig festlegen, auf welche Weise Vorbelastungen und Beeinträchtigungen zu berücksichtigen sind. Idealerweise fließen Parameter wie Intensität, Frequentierung oder Dauer in die Entscheidung ein.
Die Bewertung des Landschaftsbildes muss einheitlich, in sich schlüssig und nachvollziehbar erfolgen, um im Rahmen der Kompensationspflicht die Höhe des Ersatzgeldes neutral und rechtssicher zu ermitteln.
In verschiedenen Genehmigungsverfahren setze ich mich intensiv mit der Bewertung des Landschaftsbildes sowie der Bemessung des Ersatzgeldes auseinander. Die Erfahrung zeigt, dass trotz Bestehen gängiger Kompensationsmodelle häufig nur individuelle Lösungen zu befriedigenden und verträglichen Ergebnissen für Vorhabenträger, Genehmigungsbehörde und Umwelt führen.
Mehr zum Thema:
BfN/Roth, M. & E. Bruns (2016): Landschaftsbildbewertung in Deutschland
Wikipedia: Artikel „Landschaftsbild“