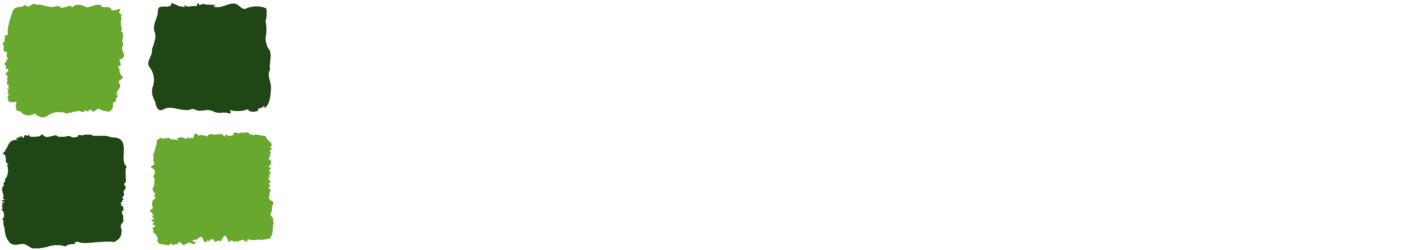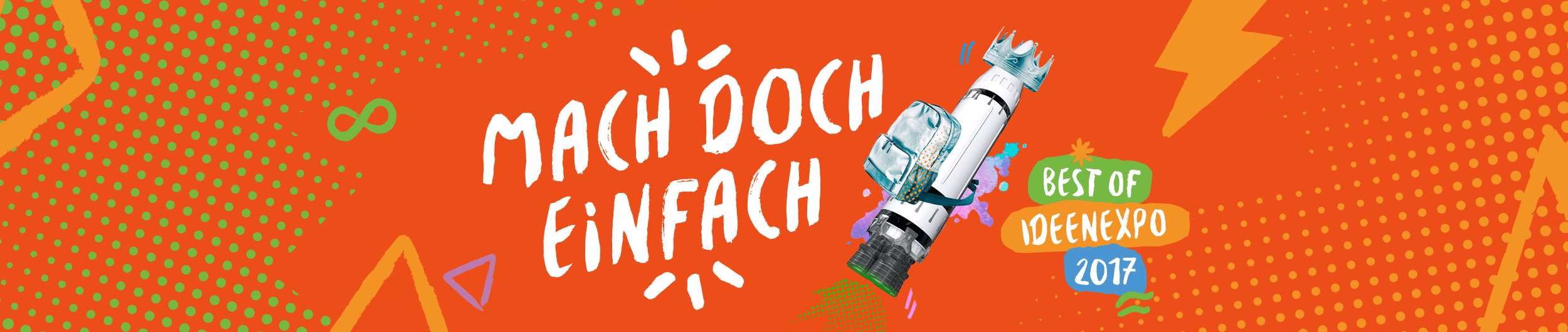Im Rahmen einer Überprüfung und Aktualisierung bekannter Vorkommen der Knoblauchkröte in Niedersachsen führte das Büro für Landschaftsplanung, Ökologie und Umweltforschung in 2018 und 2019 Untersuchungen an mehr als 60 Standorten durch.
Neben der unter anderem mittels Hydrophon zu erfassenden Knoblauchkröte wurden dabei auch Nachweise zu anderen Amphibienarten wie Erdkröte, Grasfrosch, Laubfrosch, Teichfrosch und Molchen sowie zu Reptilien geführt.
Der außergewöhnlich niederschlagsarme Sommer 2018 führte indessen landesweit zu geringen Wasserständen und zur Austrocknung auch größerer Untersuchungsgewässer, weshalb die Erfassungen in der darauffolgenden Kartiersaison wiederholt wurden. Auch hier kam es witterungsbedingt zur frühzeitigen Austrocknung vieler Gewässer und mitunter zum Totalverlust der Reproduktion früh laichender Arten.
Die untersuchten Lebensräume befanden sich überwiegend innerhalb von ausgedehnten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen – wesentliche Beeinträchtigungen terrestrischer Habitate ergaben sich demzufolge aus der Beseitigung bzw. Bewirtschaftung von Saumbiotopen und Leitstrukturen sowie einer zunehmenden Ausweitung von Monokulturen, während die Zerschneidung durch Straßen oder Wege nur eine untergeordnete Rolle spielte.
Gerade die maschinelle Bodenbearbeitung (Verletzung, Tötung) und das Ausbringen von Pestiziden und Nährstoffen (Verätzung, Vergiftung) stellen für die Knoblauchkröte aufgrund ihrer Lebensweise eine besondere Gefahr dar. Für nahezu alle untersuchten Gewässer wurden außerdem Beeinträchtigungen, insbesondere durch Eutrophierung, zunehmende Beschattung durch Ufergehölze, fortschreitende Verlandung sowie durch Vermüllung festgestellt.
Mehr zum Thema:
Feldherpetologie.de: Artensteckbrief „Knoblauchkröte“
Wikipedia: Artikel „Knoblauchkröte“